Einleitung
Schlecker – dieser Name war einst auf fast jeder deutschen Einkaufsstraße zu sehen. Die blau-weißen Filialen gehörten über Jahrzehnte zum Alltag von Millionen Menschen. Doch was als kleines Familienunternehmen begann, wurde zum Symbol für rasant wachsenden Einzelhandel – und später für Managementfehler, Missstände und einen spektakulären Niedergang. Ein Rückblick auf die Geschichte der Schlecker-Drogeriemärkte.
—
Die Anfänge:
Die Geschichte beginnt 1975, als Anton Schlecker – gelernter Metzgermeister aus Ehingen (Baden-Württemberg) – seine erste Drogerie eröffnet. Hintergrund war die Liberalisierung des Einzelhandels durch das neue Apothekengesetz, das es erlaubte, Drogerien auch außerhalb des Apotheker-Umfelds zu betreiben.Mit einer klaren Strategie – niedrige Preise, einfache Ladengestaltung und dezentrale Expansion – traf Schlecker den Nerv der Zeit. Schon 1977 gab es über 100 Filialen, 1980 waren es 1.000. Damit wurde Schlecker zum Pionier im deutschen Drogeriemarkt.
—
Der Aufstieg: Expansion ohne GrenzenI
n den 1980er- und 90er-Jahren folgte eine aggressive Wachstumsphase. Schlecker expandierte europaweit – unter anderem nach Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und in die Niederlande. Auf dem Höhepunkt verfügte das Unternehmen über mehr als 13.000 Filialen in 17 Ländern und beschäftigte rund 50.000 Mitarbeitende.Charakteristisch für Schlecker war der Fokus auf kleine, oft inhabergeführte Läden in ländlichen Regionen. So war Schlecker überall präsent – oft auch dort, wo sich andere Ketten nicht lohnten.
—
Kritik am System: Personal und Preisdruck
Trotz des Erfolgs wurde Schlecker immer wieder für seine Arbeitsbedingungen kritisiert. Besonders auffällig:Niedrige Löhne und befristete VerträgeEinzelbesetzung in Filialen, was Überlastung bedeuteteStrikte Hierarchien und rigide KontrolleSpätestens in den 2000er-Jahren wurde der Name Schlecker zunehmend mit einem autoritären Führungsstil und schlechten Arbeitsbedingungen verbunden. Ein interner Skandal sorgte 2006 für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass Mitarbeiter systematisch überwacht worden waren – auch mit versteckten Kameras.
—
Der Konkurrenzdruck wächst
Während Schlecker an seinem Filialkonzept festhielt, modernisierten sich Konkurrenten wie dm und Rossmann. Sie setzten auf größere, freundlichere Läden, breiteres Sortiment, Bio-Produkte und Markenvielfalt – und trafen damit den Zeitgeist.Schlecker hingegen blieb beim spartanischen Konzept: wenig Personal, kaum Umbauten, kaum Digitalisierung. Diese Stagnation wurde zum Verhängnis. Die Kunden blieben zunehmend aus.
—
Der Zusammenbruch: Insolvenz 2012
Am 23. Januar 2012 meldete Anton Schlecker Insolvenz an. Der einstige Branchenprimus war zahlungsunfähig – ein Schock für die Öffentlichkeit. Über 30.000 Mitarbeitende standen vor einer ungewissen Zukunft.Die Schlecker-Filialen wurden in mehreren Wellen geschlossen, der Versuch, Teile der Kette zu retten oder Investoren zu finden, scheiterte. Auch ein Sanierungsversuch durch Schleckers Kinder, die mit der Kette “Schlecker XL” ein neues Konzept testen wollten, blieb erfolglos.Im Juni 2012 war das endgültige Aus besiegelt.
—
Die strafrechtliche Aufarbeitung
Nach der Insolvenz begann die juristische Aufarbeitung. 2017 wurde Anton Schlecker wegen vorsätzlichen Bankrotts und Untreue zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Seine Kinder, Lars und Meike Schlecker, erhielten Haftstrafen ohne Bewährung. Vorwurf: Geldmittel seien aus dem Unternehmen gezogen worden, obwohl sich Schlecker in einer wirtschaftlichen Krise befand.
—
Was bleibt von Schlecker?
Heute ist von Schlecker wenig übrig. Viele ehemalige Filialen wurden von dm, Rossmann oder anderen Einzelhändlern übernommen. Der Name „Schlecker“ ist vor allem ein Beispiel für verpasste Chancen, mangelnde Anpassung und ein autoritäres Geschäftsmodell, das nicht mit der Zeit ging.Gleichzeitig war Schlecker auch ein Symbol für Nahversorgung im ländlichen Raum – etwas, das viele nach dem Verschwinden schmerzlich vermissten.
—
Fazit
Die Geschichte von Schlecker ist eine klassische „Rise and Fall“-Erzählung: Aus kleinen Anfängen wurde ein europaweites Imperium – und aus unternehmerischem Eigensinn wurde am Ende ein dramatischer Kollaps. Der Fall Schlecker zeigt eindrücklich, wie wichtig Innovation und Wandelbereitschaft sind, dass Personalpolitik langfristig über den Erfolg eines Unternehmens mitentscheidet.

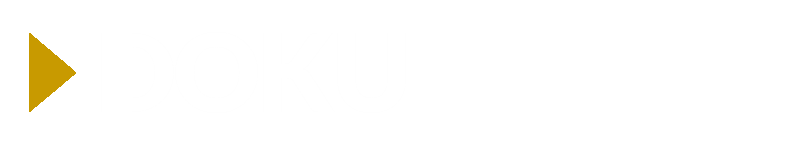
Schreibe einen Kommentar