Am 10. Juli 1968 geschah etwas Außergewöhnliches und Verheerendes in der Region Pforzheim: Ein Tornado der Stärke F4 (nach der Fujita-Skala) zog über Teile des Nordschwarzwaldes, überquert Stadtgebiete – und hinterließ eine Schneise der Verwüstung, die noch Jahrzehnte später in Erinnerung blieb. Dieses Ereignis zählt zu den schwersten Tornados in der deutschen Wettergeschichte.
Wetterlage und Entstehung
- Der Tag begann heiß und schwül. Besonders in den Rheintälern stiegen die Temperaturen über 30 °C, die Luftfeuchtigkeit war hoch.
- Oben in höher liegenden Schichten lag trockene Luft, und es herrschte eine starke Windscherung – das heißt, der Wind änderte mit der Höhe deutlich seine Richtung und Stärke. Diese Bedingungen sind oft günstig für die Entstehung starker Gewitterzellen, die dann Tornados auslösen können.
- Um den Abend herum entwickelte sich über Frankreich eine kräftige Gewitterfront, die sich dann in Richtung Pforzheim fortbewegte.
Verlauf des Tornados
- Der Tornado zog über eine Zugbahn von etwa 30‑35 km Länge in Deutschland, nachdem er über Frankreich schon Schäden angerichtet hatte.
- Die betroffene Schneise war stellenweise bis zu 500 Meter breit und verschonte weder Stadt noch Land: Waldgebiete, Wohnviertel, Industrie- und Infrastrukturobjekte wurden schwer getroffen.
- In Pforzheim selbst war der Süden der Stadt besonders stark betroffen, sowie die Siedlung Neubärental, Ottenhausen, Rudmersbach und weitere Orte.

Schadensbilanz
- Häuser und Gebäude: Rund 3.700 Häuser wurden beschädigt, sechs Häuser wurden total zerstört. Viele Dächer abgedeckt, Fenster zerstört.
- Personelle Folgen: Zwei Menschen starben unmittelbar durch den Tornado, ein weiterer Dachdecker später bei Aufräumungsarbeiten. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt.
- Infrastruktur: Stromversorgung war unterbrochen – in Pforzheim waren über 1000 Haushalte betroffen. Der Wiederaufbau der Stromleitungen dauerte Tage.
- Geldschaden: Der Sachschaden wurde auf etwa 130 Millionen D‑Mark (1968) geschätzt. Mit der Zeitwertentwicklung entspricht das heute deutlich höheren Summen.
Rettungsmaßnahmen und Folgen
- Einsatzkräfte aus vielen Bereichen – Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), die Bundeswehr und auch die US‑ und französischen Streitkräfte in der Region – halfen bei Aufräum-, Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen.
- Der Wiederaufbau zog sich über Wochen; viele betroffene Gebiete litten noch länger unter den Folgen wie unterbrochene Versorgungen, beschädigte Straßen, zerstörte Infrastruktur.
Bedeutung und Lehren
- Der Tornado von Pforzheim zeigt: Auch in Deutschland sind Naturereignisse extremen Ausmaßes möglich – Tornados sind keine rein außereuropäische Gefahr
- In den Jahrzehnten danach wurde die Beobachtung solcher Wetterereignisse verbessert, ebenso das Bewusstsein in Bevölkerung und Behörden für Wetterwarnsysteme. Aber: 1968 gab es keine moderne Tornadowarnung wie heute.
- Viele Zeugen berichten noch heute, wie unvermittelt der Sturm kam – wie Dachbalken, Autos, Teile von Gebäuden durch die Luft gewirbelt wurden, und wie aus Idylle auf einmal Chaos wurde.
Nachwirkungen und Erinnerung
- In den betroffenen Wäldern von Pforzheim und Umgebung sind Schäden auch Jahrzehnte später noch sichtbar oder in ihrer Geschichte dokumentiert (z. B. Menge an zerbrochenem Holz, Fläche zerstörter Wälder).
- Ein Gedenkstein („Tornadostein“) erinnert bei Büchenbronn an die zerstörerische Schneise und an die Naturgewalt dieses Sturms.
- Wetterdienste und meteorologische Institute sehen das Ereignis als Warnbeispiel: solche Extremwetterlagen sind selten, aber nicht unmöglich, auch in gemäßigten Klimazonen wie Baden-Württemberg.
Fazit
Der Tornado vom 10. Juli 1968 war kein gewöhnliches Gewitter – er war ein Wetterereignis, das viele bisher für unmöglich hielten: zerstörerisch, schnell und überraschend. Für Pforzheim und die umliegenden Gemeinden war es eine Nacht, die viele Leben und die Wahrnehmung von Naturgefahren veränderte.
Er erinnert daran:
- wie wichtig es ist, auf Wetterwarnungen zu achten,
- wie resilient Menschen und Gemeinden sein können, wenn sie zusammenarbeiten, und
- dass Naturgewalten auch in Regionen eintreten können, in denen man sie nicht täglich erwartet.
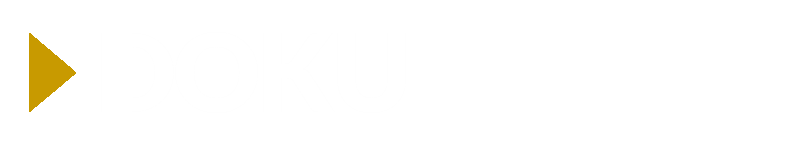

Schreibe einen Kommentar